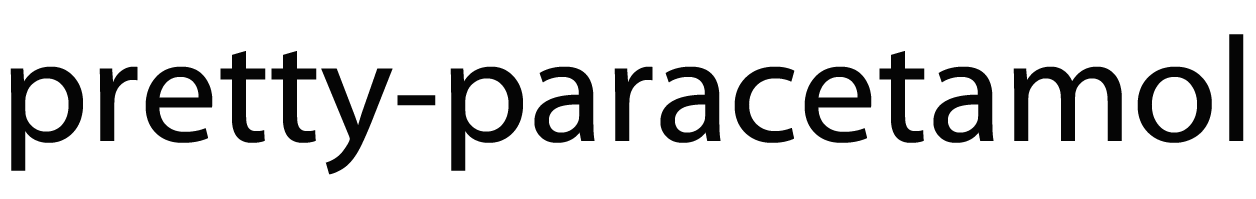Ort: Palladium, Köln
Vorband: Lo moon

Ach wie lustig. Zwei Tage später stoße ich beim Googlen auf einen Konzertbericht über das The war on drugs Konzert im Palladium. Die drei letzten Sätze lauten:
Die Band ist definitiv auf ihrem bisherigen Karrierehöhepunkt. Nach der letzten Nummer “In Chains” stellt sich eigentlich nur die Frage, wo und wann wir diese große Rockband wiedersehen werden. Wahrscheinlich nicht im Palladium.
Der Bericht beim jmc-Magazin stammt aus dem Jahr 2018. Das sehe ich aber erst nach einigen Minuten, als ich auf das Datum des Berichts schaue. Zuvor wunderte ich mich erstmal, denn die erwähnten Songs haben The war on drugs an diesem Abend doch gar nicht gespielt.
A ha, ‚wahrscheinlich nicht im Palladium‘, steht da. Interessant. Aber leider falsch.
Ich stehe im Palladium.
Warum habe ich nochmal dieses Ticket? Ich kriege es nicht mehr zusammen und bin tatsächlich ein bisschen über mich erstaunt. The war on drugs. Das war doch die Band, die mich live irgendwann mal ziemlich geflasht hat und dann ziemlich in meiner Wahrnehmung verschwunden ist? The war on drugs. Die Band, die phasenweise so schöne Dire Straits Harmonien hat und auch so ziemlich als einzige Band in dieser Dekade noch elende Gitarrensoli spielen darf. Waren das vielleicht die Gründe für den Kauf? Die Erinnerung, oder die verklärte Erinnerung an ein schönes Konzert, von dem ich nicht mehr weiß, wann und wo es stattgefunden hat?
Um nicht ganz dumm dazustehen, höre ich tags zuvor nochmal Lost in the dream, das einzige Album, das ich von The war on drugs besitze. Das ist mittlerweile schon acht Jahre alt und besitzt mit A deeper understanding und dem aktuellen I don’t live here anymore zwei Nachfolger. Direkt bin ich wieder verliebt in „Under the pressure“, „An ocean in between the waves“ oder „Red eyes“. Lange nicht mehr gehörte Lieblingslieder. Die ersten beiden Songs spielen sie auch an diesem Abend, es sind meine Momente mit dem höchsten Wiedererkennungs- und Wohlfühlwert.
Ich bin spät dran, echt spät dran. Den ganzen Tag über wächst keinerlei Vorfreude auf den Abend. Gehe ich zum Konzert, gehe ich nicht. Es ist mir ein bisschen egal. So sitze ich erst um 19 Uhr in der Bahn in die große Stadt. Die angekündigte Vorband, so hatte ich am Abend zuvor entschieden, schenke ich mir. Lo Moon kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Der Name klingt mir etwas suspekt, und als ich lese, dass der Sohn von Dave Stewart in der Band Gitarre spielt, nehmen meine Zweifel nicht ab. Da hilft auch ein Videostudium von „Raincoats“ vom aktuellen Album Modern life nichts. Ich breche den Versuch nach zwei Minuten ab. Das ist nichts für mich.
Pünktlich zur Umbaupause bin ich vor Ort; von Lo Moon habe ich keinen Ton mitbekommen. Dabei ist es erst kurz nach halb neun. Es war scheinbar ein kurzer Auftritt. Die Reihen sind nur luftig gefüllt. Das Palladium ist an diesem Abend bei Weitem nicht ausverkauft. Leicht gelingt es mir, nach vorne durchzugehen. Ich will ja schließlich was sehen und nicht nur die Lichtshow genießen. The war on drugs sind 2022 eine große Band, entsprechend opulent sind ihr Equipment und die Bühnenaufbauten. Lichtshow inklusive. Sechs oder sieben Musiker*innen, so genau sehe ich das nicht, einer der berühmten Palladiumpfeiler begrenzt mein Sichtfeld, liefern musikalisch das Erwartete.
Adam Granduciel schniedelt seine Gitarrensoli, dass ihm nicht nur ums Herz warm wird. Bereits nach zwei, drei Songs verschwindet er kurz von der Bühne, um sein Holzfällerhemd gegen ein T-Shirt einzutauschen. Mir zieht’s dagegen weiterhin kühl am Rücken, was aber nicht heißt, dass mich die Gitarrensoli frösteln lassen. Es liegt vielmehr an einer offenen Hallentür.
Gitarrensoli also, sanft und harmonisch. Dazu schöne Rockmelodien und ein Gesang, der mich ab und an an Mark Knopfler denken lässt. Mark Kozelek nennt das ‘beer commercial lead guitar shit’ und ausführlicher:
You sound like Don Healey meets John Cougar meets Dire Straits meets ‘Born in the USA’ era Bruce Springsteen. It’s not a criticism, it’s an observation.
Es gab da mal einen Streit zwischen Mark Kozelek und Adam Granduciel, bzw. einen einseitigen Disput. Und wenn Mark Kozelek jemanden auf dem Kieker hat, dann so richtig. Dann bleibt es nicht bei ein paar Worten, dann schreibt er einen Song darüber. Im Fall von The war on drugs sogar zwei. Beide sind nicht nett.
Dire Straits und Bruce Springsteen Vergleiche ziehe ich auch. Hier und da höre ich sie deutlich heraus. Bei „Burning“ oder „Eyes to the wind“ zum Beispiel. Aber ich nenne die Vergleiche nicht despektierlich. Ich mag beide Bands/Musiker. „Telegraph Road“ oder Nebraska sind uneingeschränkte Meisterwerke. Ein Vergleich mit beiden ist mehr ein Lob.
„Red eyes“ hat immer noch diese tolle seichte Gitarre. Das fällt mir live gleich wieder auf. „Living proof“ im Anschluss fällt mir auch auf. Der Song ist fürchterlich. Es ist eine Americana-New Folk Schnulze, die überhaupt nicht funkt. Es ist der schwächste Song des Abends. „Under the pressure“ zerren sie später auf über 10 Minuten. So wie zuvor schon „Harmonia’s dream“. Dazwischen spielen sie irgendwann „Burning“, und ich denke an Bruce Springsteen. Ach, großartig dieser 1980s Rock.
Setlist:
01: Old skin
02: Pain
03: An ocean in between the waves
04: I don’t wanna wait
05: Victim
06: Strangest thing
07: Red eyes
08: Living proof
09: Harmonia’s dream
10: Burning
11: Rings around my father’s eyes
12: Under the pressure
13: I don’t live here anymore
14: Occasional rain
Zugabe:
15: Thinking of a place
16: In chains
18: Lost in the dream
Kontextkonzerte:
The war on drugs – Berlin, 23.05.2014 / Bi Nuu